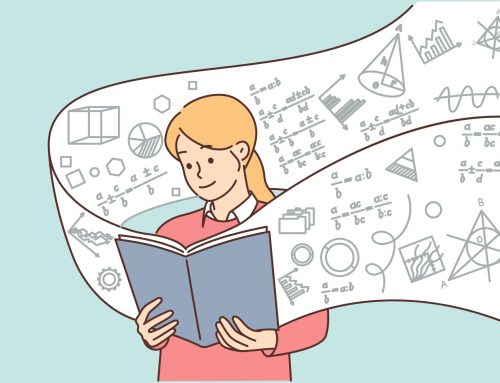In einem früheren Beitrag habe ich bereits das Spannungsfeld von Innovation, Exnovation und Fortschritt beschrieben. Heute möchte ich ein Thema aufgreifen, das allgegenwärtig ist: Disruption. Doch was steckt eigentlich hinter dem Begriff? Und was hat das mit Judo zu tun?
Was ist Disruption?
Häufig werden Disruption oder disruptive Technologien mit bahnbrechenden Erfindungen gleichgesetzt, die sich aufgrund ihrer Innovationskraft durchsetzen. Doch das ist nicht der Kern von Disruption. Im eigentlichen Wortsinne geht es um Zerstörung. Das klingt vielleicht plakativ, aber eine disruptive Technologie hat nicht den Anspruch, bestehende Technologien zu verbessern oder zu ergänzen. Es geht darum, einen bestehenden Markt zu zerstören und durch einen neuen Markt zu ersetzen. Folglich ist nicht jede Innovation disruptiv, und nicht jede Disruption muss besonders innovativ sein. Doch dazu später mehr.

Grundsätzlich lässt sich nach dem Wirtschaftswissenschaftler Clayton M. Christensen zwischen sustaining technologies und disruptive technologies unterscheiden. Etablierte Firmen nutzen sustaining technologies, um ihr bisheriges Geschäftsmodell zu stützen und auszubauen. Hierbei kann es sich durchaus um eine große Innovation handeln, die entsprechend komplex und anspruchsvoll ist. Hier spielen etablierte Firmen ihre Vorteile (Know-how, Erfahrung, Kapital) aus und die Einstiegshürden für neue Marktteilnehmer sind entsprechend hoch. Ein gutes Beispiel sind die Hersteller von Verbrennungsmotoren. Hier fließen große Summen in Forschung und Entwicklung, um diese effizienter zu machen. Ein neues Unternehmen hätte es wahnsinnig schwer, in einen solchen Markt einzudringen, es bräuchte sehr viel Kapital und Ressourcen.
Im Gegensatz dazu kann es Markteinsteigern mit disruptive technologies gelingen, die alteingesessene Konkurrenz zu verdrängen. Dies wird oft von etablierten Firmen unterschätzt. Letztlich führen diese Technologien zu einem Umbruch, so dass ein neuer Markt entsteht. Das Beispiel ist hier das Unternehmen Tesla, welches sehr viel einfachere Elektromotoren einsetzt. Mit Verbrennungsmotoren kann und will Tesla gar nicht direkt konkurrieren. Das Ergebnis kennen wir: Mittelfristig werden Elektroautos die Verbrenner vom Markt verdrängen.
Mit der Judo-Strategie die Konkurrenz aushebeln
Doch warum lassen alteingesessene Firmen Disruption zu? Warum sind sie nicht selbst disruptiv? Die Frage stellt sich für jeden, der in einer etablierten Firma arbeitet. Warum baut Volkswagen nicht schon seit 10 Jahren konsequent nur noch Elektroautos? Warum stellen nicht alle Versicherer auf digitale Vertriebswege und Verwaltungsprozesse um, wie es einige bekannte Insurtechs vormachen?
Letztlich zeichnet genau das disruptive Innovationen aus: Etablierte Unternehmen können sich dagegen nicht wehren. Ansonsten wäre es keine Disruption. Wehren könnten sie sich nur, indem sie eben auch selbst ihren eigenen Markt zerstören. Doch wer zerstört schon seinen angestammten Markt, wenn man noch gar nicht weiß, ob sich die neuartige Technologie tatsächlich durchsetzen wird? Hier schlägt der Rückschaufehler (hindsight bias) zu. In der Rückschau wird oft überschätzt, dass wir die Entstehung eines neuen Markts genau so hätten vorhersehen können. Das heißt, zum Zeitpunkt der Entscheidung wissen wir es noch nicht. Das Management oder den Eigentümer zu überzeugen, das bisherige Geschäftsmodell aufzugeben – bei unklaren Erfolgschancen – ist kaum vorstellbar. Für den neuen Marktteilnehmer ist es natürlich kein Problem, einen bestehenden Markt zu zerstören, er hat in dem Sinne nichts zu verlieren.

Bestehende Unternehmen sind hier also in einem Dilemma, sie sind nicht einfach naiv oder langsam. Wenn man es genau nimmt, machen sie ihren eigentlichen Job sogar richtig gut. Und hier kommt der Begriff der Judo-Strategie ins Spiel. Disruptoren geht es darum, die Größe und Kraft bestehender Unternehmen quasi gegen diese selbst zu verwenden.
Um die Judo-Strategie an einem Beispiel zu veranschaulichen, gehen wir zurück in das Jahr 2007. Apple hat gerade das neue iPhone herausgebracht. BlackBerry war insbesondere bei den Geschäftskunden sehr erfolgreich. Die Verkaufszahlen und Gewinne stiegen sogar über die nächste Zeit noch an. Dem Management wurde über entsprechende Gewinne und zufriedene Kunden signalisiert, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Das hat den Raum für neue Konkurrenz geöffnet. Das alte Unternehmen ist machtlos: Es muss sehenden Auges zulassen, wie es von der Konkurrenz aufs Kreuz gelegt wird.
Disruption funktioniert zusätzlich, da Unternehmen sich in bestimmten Aspekten nur sehr schwer ändern können. Letztlich gibt es drei Dinge die entscheiden, was ein Unternehmen tun oder nicht tun kann:
- Ressourcen: Alles, was eine Firma kaufen, verkaufen, anstellen oder entlassen kann
- Prozesse: Handlungsmuster, Kommunikations- und Entscheidungswege, wie ein Unternehme seine Ressourcen verwaltet.
- Werte: Kriterien anhand derer Entscheidungen getroffen werden
Die Reihenfolge beschreibt zudem wie schwer es ist, solche Dinge zu ändern. Aber die Umstellung auf eine disruptive Technologie erfordert eben genau Änderungen an Prozessen und Werten, die das Unternehmen bislang erfolgreich gemacht hat.
Bewusste Verschlechterung als Strategiemerkmal
Woran erkennen wir also nun disruptive Technologien? Entgegen der Intuition sind die meisten Innovationen mit hoher Erfindungshöhe eher den sustaining technologies zuzuordnen. Disruptive Technologien sind oft keine technologischen Sprung-Entwicklungen. Im Gegenteil, sie sind meist technisch gesehen einfach, sonst wäre es für Marktneulinge nicht ohne Weiteres möglich, solche Technologien anzuwenden. Die etablierten Firmen sind fähig, solche Technologien zu liefern.
Der Clou ist zudem, dass disruptive Technologien (bewusst) Verschlechterungen von bestehenden Produkten darstellen. Nur deshalb kann ein vorhandenes Unternehmen darauf nicht reagieren. Es würde dem bestehenden Geschäftsmodell widersprechen und bestehende Kunden verärgern. Hier noch einmal das Beispiel mit BlackBerry. Das erste iPhone war schlecht – aus Sicht der Geschäftskunden von BlackBerry. Es gab zu viele Einschränkungen. Aber das iPhone spricht eine andere Zielgruppe an. Gerade bei Apple-Produkten ist diese bewusste Verschlechterung anhand von konkreten Einschränkungen ein wesentliches Strategie-Merkmal. Auch bei Elektroautos war das der Fall. Die ersten Modelle hatten durch die Bank lausige Reichweiten. Ein neues Unternehmen kann solche Einschränkungen machen, weil es eben eine andere Zielgruppe anspricht.
Angriff ist die beste Verteidigung
Bislang wird der Eindruck erweckt, dass ein etabliertes Unternehmen einfach machtlos ist. So einfach ist es natürlich nicht. Als erste Maßnahme sollte der Markt regelmäßig nach disruptiven Technologien gescannt werden. Durch entsprechende Ausgründungen kann ich diesen aktiv begegnen. Solche Tochterunternehmen sind kleiner, können auch mit kleineren Margen gut leben. Klar ist aber, dass mit Misserfolgen zu rechnen ist und eine entsprechende Fehlerkultur notwendig ist.
Als sich durch die ersten PCs ein vielversprechender Markt abzeichnete, gründete IBM eine eigenständige Organisation, der entsprechende finanzielle Mittel und Ressourcen gestellt wurden. Aus dem Rest (Prozesse, Werte) hat sich IBM rausgehalten. Dieses Tochterunternehmen konnte sich jetzt auf den PC-Markt ausrichten und fokussieren. So konnte IBM weiterhin Profit mit ihrem regulären Geschäft machen und hat sich über die Tochter einen Platz an einem vielversprechenden Markt gesichert.
Die Erkenntnis ist also, dass es für Unternehmen fast unmöglich ist, zugleich Märkte für sustaining und disruptive technologies zu bedienen. Durch den Aufbau von getrennten, auf disruptive Technologien spezialisierte Einheiten lässt sich dieses Problem umgehen.